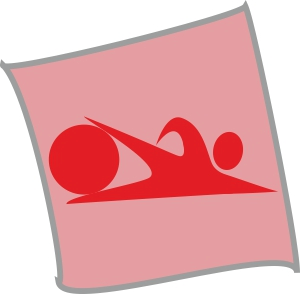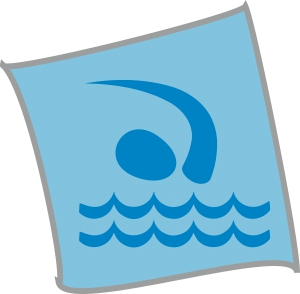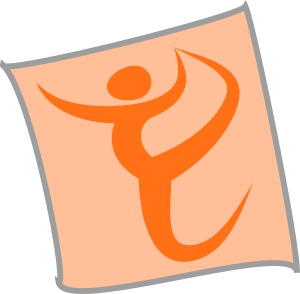Wissenschaftliche Grundlagen
Ein Curriculum als Orientierungsrahmen wird als Voraussetzung für die umfassende Förderung von Kindern und Jugendlichen in und durch Bewegung, Spiel und Sport angesehen. Auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses von Zielen und Kompetenzerwartungen wird ein abgestimmtes Zusammenwirken der verschiedenen Akteure wie Eltern, Bildungseinrichtungen und Vereine möglich. Vor diesem Hintergrund wurde das Sächsische Curriculum für Bewegung, Spiel und Sport (Finke/Zubrägel 2012) entwickelt.
Inhalt
Anliegen des Curriculums für Bewegung, Spiel und Sport
Theoretischer Rahmen des Curriculums
Herangehensweise an die Entwicklung des Curriculums
Individuelle Handlungskompetenz in und durch Bewegung, Spiel und Sport
Ziele der Bewegungsbildung
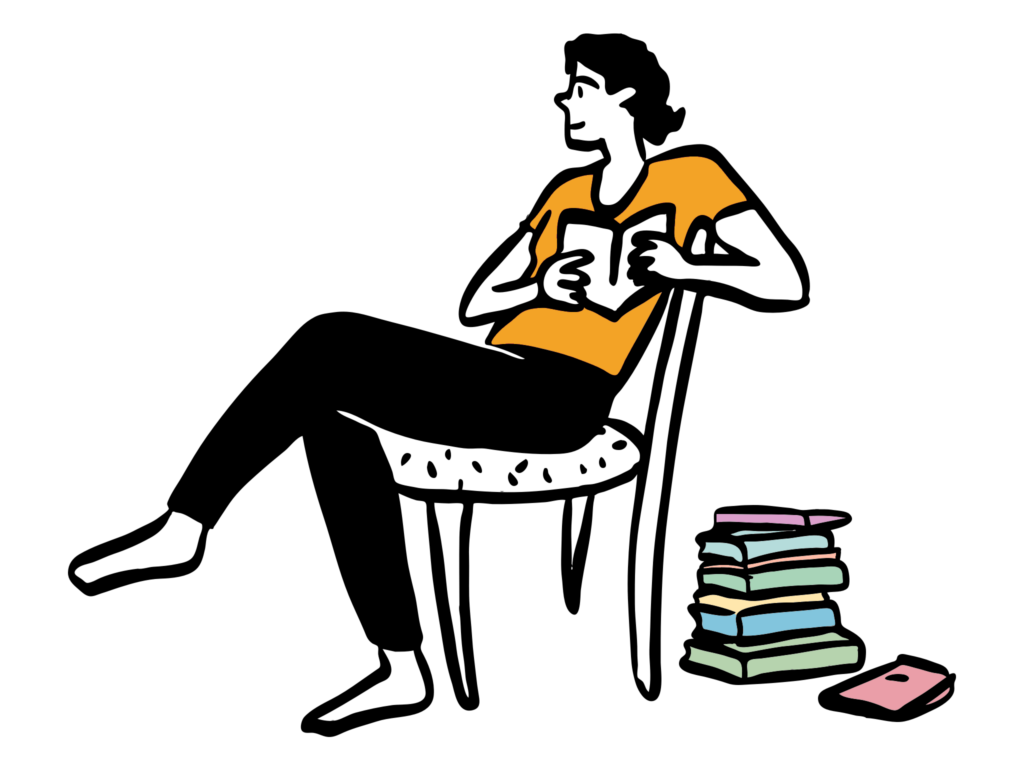

Anliegen des Curriculums für Bewegung, Spiel und Sport
Lehrkräfte, Eltern, Erzieher, Trainerinnen, Übungsleiter, Erlebnispädagoginnen und weitere Akteure im Bereich Bewegung und Sport eint das Anliegen, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse und die Freude an Bewegungsaktivitäten zu wecken und nachhaltig zu fördern. Mit besten Absichten und verschiedenen Ansätzen produzieren sie eine kaum zu überblickende Fülle an Angeboten und Konzepten. Ein Curriculum schafft die wissenschaftliche Struktur für systematisches und zielführendes Agieren. Die Aufbereitung im institutionenübergreifenden Lernportal „Junge Sachsen in Bewegung“ für den Altersbereich von 0–18 Jahren ermöglicht die abgestimmte praxisorientierte Umsetzung.
Theoretischer Rahmen des Curriculums für Bewegung, Spiel und Sport
Im Folgenden werden die Einordnung des Curriculums in die Gesundheitsförderung in Sachsen sowie sein theoretischer Bezugsrahmen dargestellt und die wesentlichen Begriffe erläutert.
BILDUNG
Kompetenzansatz
Gesundheitsförderung in Sachsen
Gesundheitskompetenz
Bewegung,
Spiel und Sport
Ernährungs- und
Verbraucherbildung
Lebenskompetenz
Bewegungsbildung
Bildungspotenziale und pädagogische Perspektiven
Ziele der Bewegungsbildung
Der junge Erwachsene …
- verfügt über ein positives Selbstkonzept in und durch Bewegung, Spiel und Sport.
- weist ein gesundheitsförderndes Bewegungsverhalten auf.
- hat das Bedürfnis nach lebenslanger Bewegungsaktivität entwickelt und gestaltet seine Bewegungsbiographie selbstbestimmt
- handelt sozial verantwortlich in und durch Bewegung, Spiel und Sport.
- ist körperlich leistungsfähig und verfügt über ein vielfältiges Bewegungsrepertoire.
Handlungskompetenz in und durch Bewegung, Spiel und Sport
Kompetenzen als Lernziele konkretisiert für
Lern- und Erfahrungsfelder
- Prävention und Gesundheit
- Laufen, Springen, Werfen
- Bewegen im Wasser
- Kräfte messen und miteinander kämpfen
- Bewegen an Geräten, Turnen
- Gestalten, Tanzen, Darstellen
- Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten
- Spielformen und Sportspiele
Bildungsphasen/ Altersgruppen
| Basalphase | 0–3 Jahre |
| Elementarphase | 3–6 Jahre |
| Primarphase | 6–10 Jahre |
| Sekundarphase I | 10–15 Jahre |
| Sekundarphase II | 15–18 Jahre |
- Sächsisches Curriculum für Bewegung, Sport & Spiel
- Finke, A., Zubrägel, S. (2012)

Herangehensweise an die Entwicklung des Curriculums für Bewegung, Spiel und Sport
Den Ausgangspunkt für die Annäherung an Bewegung, Spiel und Sport bildet ein modernes Bildungsverständnis. Die subjektzentrierte Perspektive verdrängt darin die tradiert institutionengebundene Perspektive und richtet den Blick auf das Bildungsgeschehen im Lebenslauf (vgl. BMFSFJ, 2005). Dabei wird Bildung als ein „Transformationsprozess der Persönlichkeit […] verstanden, der sich in der Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und der Welt vollzieht“ (Grunert, 2005, 11). Der Kompetenzansatz ermöglicht die zeitgemäße, subjektzentrierte und institutionsunabhängige Annäherung an Bewegung, Spiel und Sport im Rahmen eines Curriculums. Unter Bewegungsbildung werden alle Bildungs- und Erziehungsprozesse, die Bewegung, Spiel und Sport fördern, zusammengefasst.
- Das Sächsische Curriculum für Bewegung, Spiel und Sport – Struktur und Arbeitsgrundlage für die Akteure im Bereich Bewegung, Spiel und Sport
- Finke, A., Zubrägel, S.
- In: Sportunterricht, 63 (2014) 1, Hofmann-Verlag
Individuelle Handlungskompetenz in und durch Bewegung, Spiel und Sport
Als zentrale Zielgröße wurde Individuelle Handlungskompetenz in und durch Bewegung, Spiel und Sport postuliert. Die Autorinnen definieren sie als Bereitschaft und Fähigkeit, situationsangepasste auf Bewegungsanforderungen bezogene Handlungen zu generieren, sich dabei individuell und sozial verantwortlich zu verhalten und eigene Bewegungshandlungen sowie die anderer sachgerecht zu beurteilen und kritisch zu reflektieren. Aus dieser komplexen Zielgröße wurden Kompetenzerwartungen, die Ziele der Bewegungsbildung abgeleitet.
- Individuelle Handlungskompetenz in und durch Bewegung, Spiel und Sport
- Finke, A., Zubrägel, S. (2012)
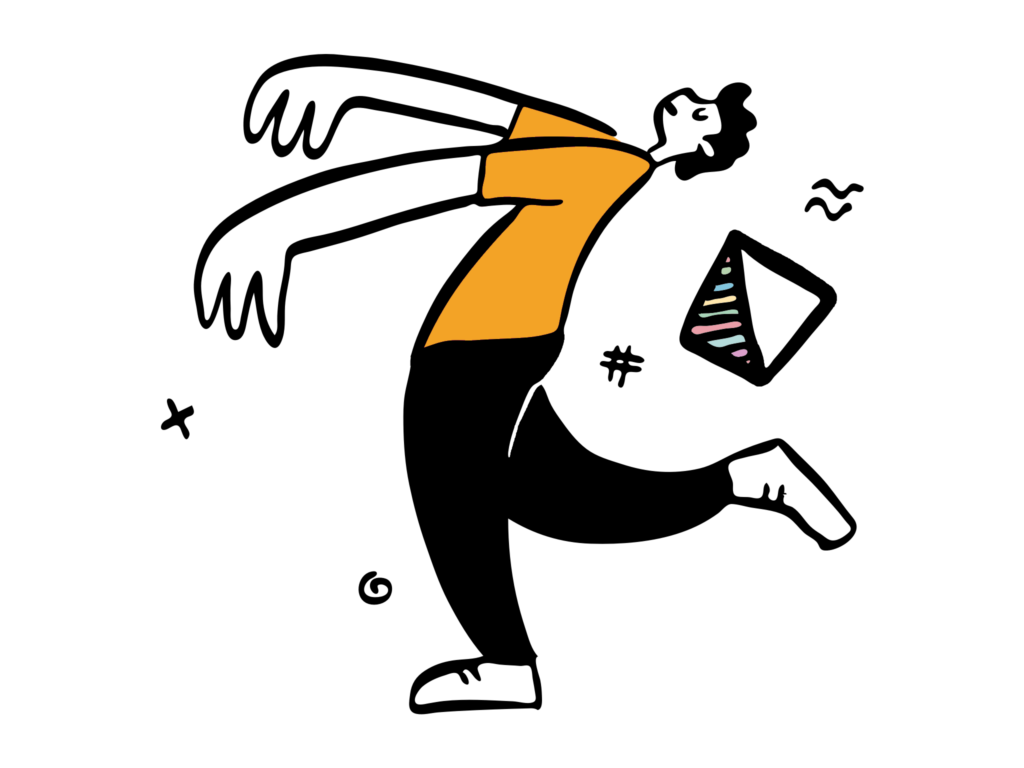

Ziele der Bewegungsbildung
Die Ziele der Bewegungsbildung sind Ausdruck eines mehrdimensionalen Zielverständnisses. Formuliert sind sie als komplexe Kompetenzerwartungen an 18-jährige junge Erwachsene.
Die/der junge Erwachsene …
- verfügt über ein positives Selbstkonzept in und durch Bewegung, Spiel und Sport,
- zeigt ein gesundheitsförderndes Bewegungsverhalten,
- hat das Bedürfnis nach lebenslanger Bewegungsaktivität entwickelt und gestaltet seine Bewegungsbiographie selbstbestimmt,
- handelt sozial verantwortlich in und durch Bewegung, Spiel und Sport und
- ist körperlich leistungsfähig und verfügt über ein vielfältiges Bewegungsrepertoire.
Die Ziele der Bewegungsbildung wurden mit Kompetenzen im Sinne von Lernzielen untersetzt. Lernziele werden dabei als Tätigkeit oder Verhaltensweise verstanden, die der Lernende nach Erreichen des Zieles zeigen kann (vgl. Bielefelder Netzwerk für die sportpädagogische Praxis, 2004). Die Kompetenzen wurden für die Aufbereitung in Lern- und Erfahrungsfeldern sowie nach Bildungsphasen und Altersgruppen gewichtet und konkretisiert, wobei entwicklungspsychologische Erkenntnisse ebenso wie Bildungs- und Lehrplananforderungen Beachtung fanden. Sie stellen ein horizontales und vertikales Zusammenwirken von aufeinander aufbauenden Lernzielen im einzelnen Lern- und Erfahrungsfeld dar.
- Ziele der Bewegungsbildung
- Finke, A., Schindhelm, A., Zubrägel, S. (2012)